Studiendesign
122 Menschen erhielten 3 Jahre lang 1.200 € pro Monat. Sie füllten regelmäßig Fragebögen aus – ebenso wie 1.580 Menschen aus der Vergleichsgruppe, die kein Grundeinkommen erhielten.
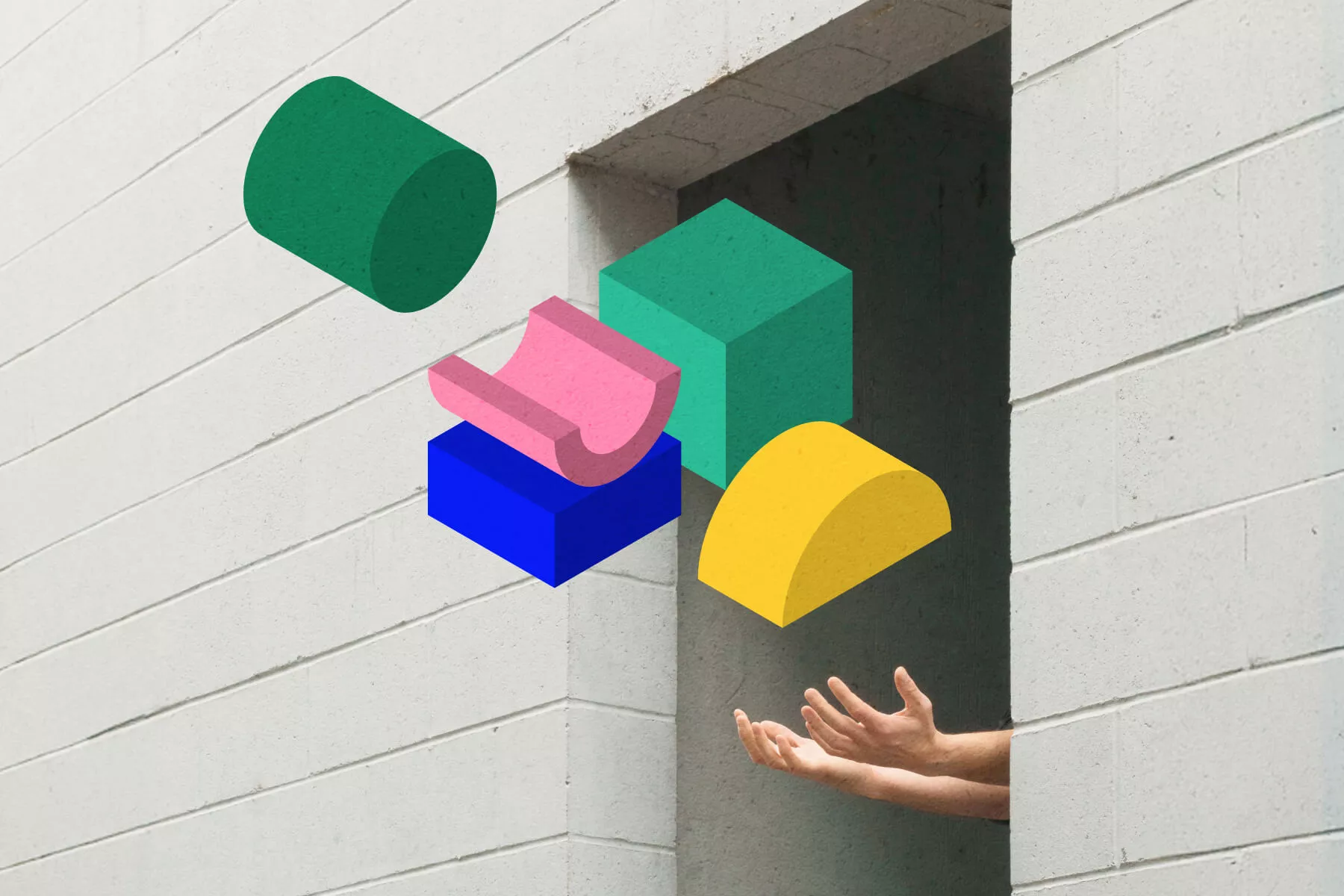
Rahmenbedingungen
Die Studie umfasste insgesamt 1.702 Teilnehmer*innen, aufgeteilt in zwei Gruppen.
122
Personen in der Grundeinkommensgruppe
- Bekamen 3 Jahre lang jeden Monat bedingungslos 1.200 € überwiesen.
- Haben alle sechs Monate einen Fragebogen ausgefüllt (Dauer: ca. 25 Minuten).
- Die Auszahlung war an keinerlei Bedingungen geknüpft: Sie konnten unbegrenzt hinzuverdienen – oder gar kein zusätzliches Einkommen haben. Es gab keine Vorgaben, Überprüfungen oder Abzüge.
1.580
Personen in der Vergleichsgruppe
- Wiesen die gleichen soziodemografischen Merkmale auf wie die Grundeinkommensgruppe.
- Haben alle sechs Monate einen Fragebogen ausgefüllt (Dauer: ca. 25 Minuten).
- Erhielten im selben Zeitraum kein Grundeinkommen.
- Bekamen Aufwandsentschädigungen für das Ausfüllen der Fragebögen.
Wie erfolgte die Auswahl der Studienteilnehmenden?
Um festzustellen, ob gemessene Effekte tatsächlich auf den Erhalt des Grundeinkommens zurückzuführen sind, und nicht etwa aus gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen erfolgen, wurde das Pilotprojekt Grundeinkommen als randomisiert-kontrollierte Studie konzipiert. Dabei wird sichergestellt, dass die Menschen in der Vergleichsgruppe sogenannte "statistische Zwillinge" der Grundeinkommensgruppe sind. Das heißt: Sie sind sich in ihren soziodemografischen Merkmalen sehr ähnlich und unterscheiden sich hauptsächlich darin, ob sie Grundeinkommen erhalten oder nicht.
Beide Gruppen sind für den Erfolg der Studie essenziell. Erst der Vergleich ihrer Erfahrungen ermöglicht es, wissenschaftliche Aussagen treffen zu können.
Um Verzerrungen zu vermeiden, wurde zusätzlich darauf geachtet, dass sich beide Gruppen zu gleichen Teilen aus Befürworter*innen und Gegner*innen des Grundeinkommens zusammensetzen.
Nicht zuletzt konzentrierte sich die Studie auf Menschen aus Ein-Personen-Haushalten im Alter zwischen 21 und 40 Jahren mit einem Haushaltsnettoeinkommen zwischen 1.100 und 2.600 Euro pro Monat. Warum genau diese Merkmale gewählt wurden, erläutern wir in unserem Journal.
Was wollte die Studie herausfinden?
Das Erkenntnisinteresse der Studie bestand in der grundsätzlichen Frage: Wie wirkt sich ein Grundeinkommen auf das Leben der Menschen aus? Oder, fachlicher ausgedrückt: Kann ein bedingungslos über einen Zeitraum von drei Jahren ausgezahlter Geldbetrag zu statistisch signifikanten Veränderungen im Handeln und Empfinden führen?
Um bei der Beantwortung dieser Frage auf einen möglichst breiten Wissensschatz zurückgreifen zu können, wurde die Studie interdisziplinär angelegt. Das bedeutet, dass die Forschung an der Schnittstelle von sozialwissenschaftlichen, psychologischen und ökonomischen Überlegungen arbeitete und sowohl Verhaltens- als auch Einstellungsänderungen in den Blick nahm.
Welche Methoden wurden dafür verwendet?
Der zentrale Bestandteil der Datenerhebung waren regelmäßige Onlinefragebögen, die alle Teilnehmenden in einem halbjährlichen Rhythmus ausfüllten. Diese Erhebungen umfassten verschiedene Lebensbereiche, darunter finanzielle Situation, Arbeitsmarktverhalten, psychisches Wohlbefinden und gesellschaftliche Teilhabe. Neben der Basisbefragung zu Beginn der Studie wurden insgesamt sieben weitere Erhebungen durchgeführt, die letzte im November 2024, um auch längerfristige Effekte über den Bezugszeitraum hinaus zu erfassen.
Im Vergleich der so gewonnenen Daten konnten Unterschiede, die sich zwischen Grundeinkommens- und Vergleichsgruppe Gruppen zeigten, gezielt auf die Auszahlung des Grundeinkommens zurückgeführt werden.
Ergänzend zu den Fragebögen wurden mit einigen Teilnehmenden vertiefende Interviews geführt, um individuelle Erfahrungen und Perspektiven detaillierter zu erfassen. Zur Untersuchung der Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und mögliche Veränderungen in Beschäftigungssituationen und Einkommensverläufen der Teilnehmenden wurden zudem anonymisierte Arbeitsmarktdaten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) herangezogen. Diese Kombination aus Methoden und Datenquellen ermöglichte eine differenzierte Analyse der Veränderungen, die durch das Grundeinkommen ausgelöst wurden.
Studienablauf
-
01
Bewerbung
Über 2 Millionen Menschen haben sich für die Studienteilnahme beworben. Das sorgte für eine exzellente Datengrundlage.
-
02
Engere Auswahl
Unter den Bewerber*innen wurde eine Gruppe von 20.000 Personen ausgewählt, die sich für die wissenschaftlichen Fragestellungen am besten eignete. Näheres zur Auswahl finden Sie in unserem Journal.
-
03
Bestimmung der Teilnehmer*innen
Aus den 20.000 geeigneten Personen wurden per Zufall 122 Menschen für die Grundeinkommensgruppe und 1.580 für die Vergleichsgruppe ausgewählt.
-
04
Erhebung
Mit dem Auszahlungsbeginn im Juni 2021 startete der dreijährige Erhebungszeitraum. Vor, während und nach dieser Zeit füllten die Teilnehmer*innen insgesamt acht Fragebögen aus.
-
05
Auswertung
Nach der letzten Auszahlung im Mai 2024 wurden die Daten der Grundeinkommensgruppe mit denen der Vergleichsgruppe abgeglichen. Dabei wurden die signifikanten Effekte herausgearbeitet und eingeordnet.
-
06
Veröffentlichung der Ergebnisse
Unter Anderem im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren wir der Öffentlichkeit die finalen Studienergebnisse am 9. April 2025.
Die Forschenden
Sozio-ökonomische Forschung

Das DIW Berlin (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) ist seit 1925 eines der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland. Es erforscht wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Zusammenhänge in gesellschaftlich relevanten Themenfeldern und berät auf dieser Grundlage Politik und Gesellschaft.
Sozio-ökonomische Forschung zu Arbeitsmarkt-Themen

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) schafft wissenschaftliche Grundlagen für fundierte Entscheidungen in der Arbeitsmarktpolitik. Mit Prozessdaten der Sozialversicherung untersuchten wir, inwiefern sich die Arbeitsmarktverläufe der Teilnehmenden am Pilotprojekt mit und ohne Grundeinkommen voneinander unterscheiden.
Psychologische Forschung

Die menschlichen Entscheidungsprozesse sind ein komplexer Vorgang. Die Wirtschaftsuniversität Wien begleitete die Teilnehmenden des Pilotprojekts, um den Einfluss des Grundeinkommens auf Einstellungen und Verhalten zu erforschen.
Ökonomische Forschung
Welchen Einfluss hat das Grundeinkommen auf ökonomische Entscheidungen? Welche Indizien lassen sich daraus für die gesamte Volkswirtschaft ableiten? Mittels eines adaptiven, experimentellen Studiendesigns finden wir den idealen Schnittpunkt aus Wirkung des Grundeinkommens und der notwendigen Besteuerung.
Verhaltensökonomische Forschung
Erklärmodelle der klassischen Ökonomie, nach denen der Mensch nur arbeitet, wenn er dafür belohnt wird, kommen beim Grundeinkommen an ihre Grenzen. Mit den Methoden der Verhaltensökonomie wurden mögliche Veränderungen in Entscheidungen und Handlungen untersucht.
Qualitative Forschung

Eine mögliche Wirkung des bedingungslos ausgezahlten Grundeinkommens sollte möglichst genau erfasst werden. Dies geschah in qualitativen Interviews mit 14 Teilnehmer*innen.
Koordination
Projektmanagement & Kommunikation

Der gemeinnützige Verein Mein Grundeinkommen e.V. führt seit 2014 Experimente mit Ein-Jahres-Grundeinkommen von 1.000 Euro und seit 2023 Drei-Jahres-Grundeinkommen von bis zu 1.200 Euro pro Monat durch. Über 2.000 Menschen wurde bereits Geld ausgezahlt. Mein Grundeinkommen betreibt die Internetseite des Pilotprojekts und koordiniert die monatlichen Spenden der über zweihunderttausend Auftraggeber*innen.
Datenerhebung

Das Meinungsforschungsinstitut pollytix strategic research erstellte die Onlinefragebögen, erhob die Daten, pflegte das Panel und garantierte die Anonymität und den Datenschutz.











